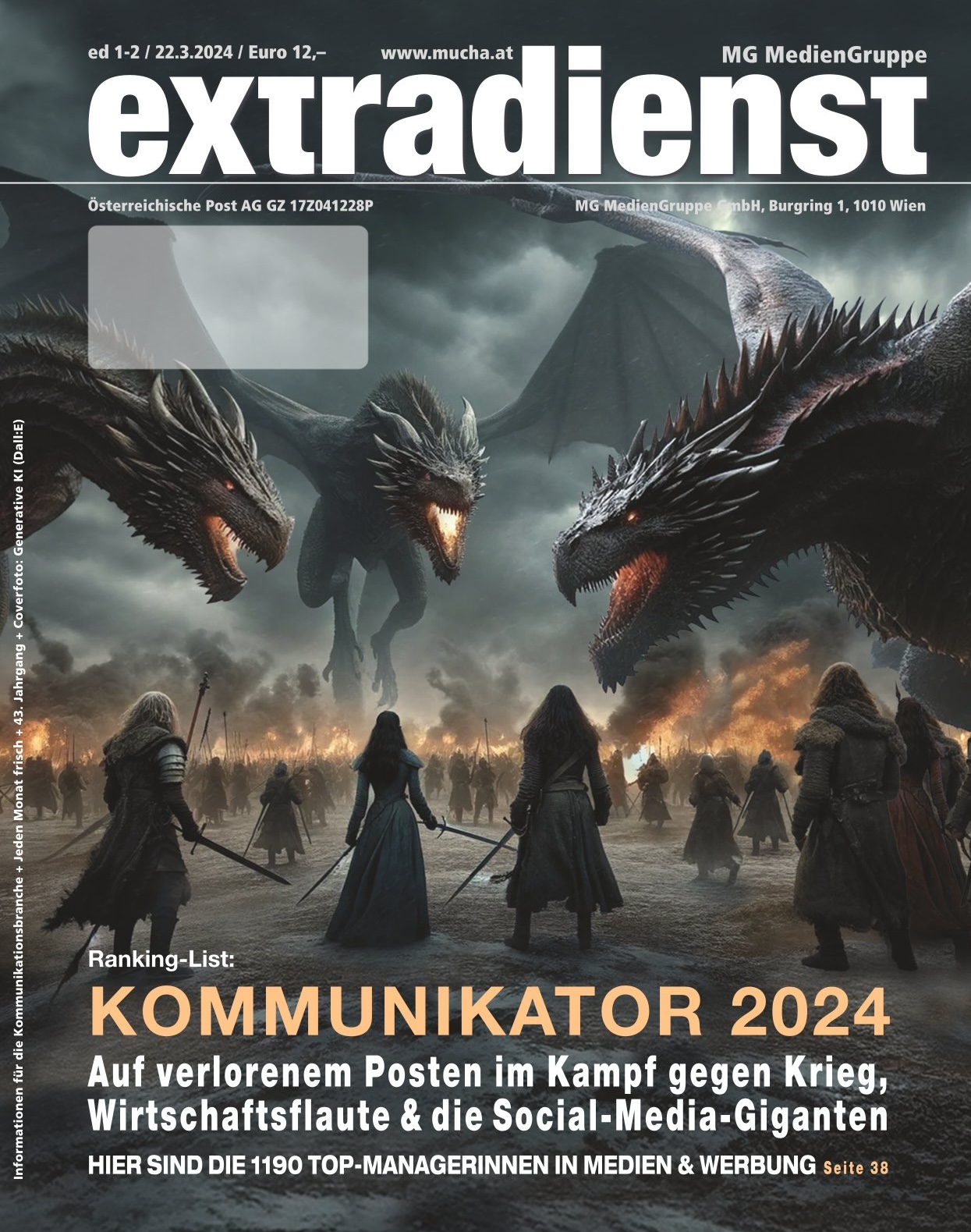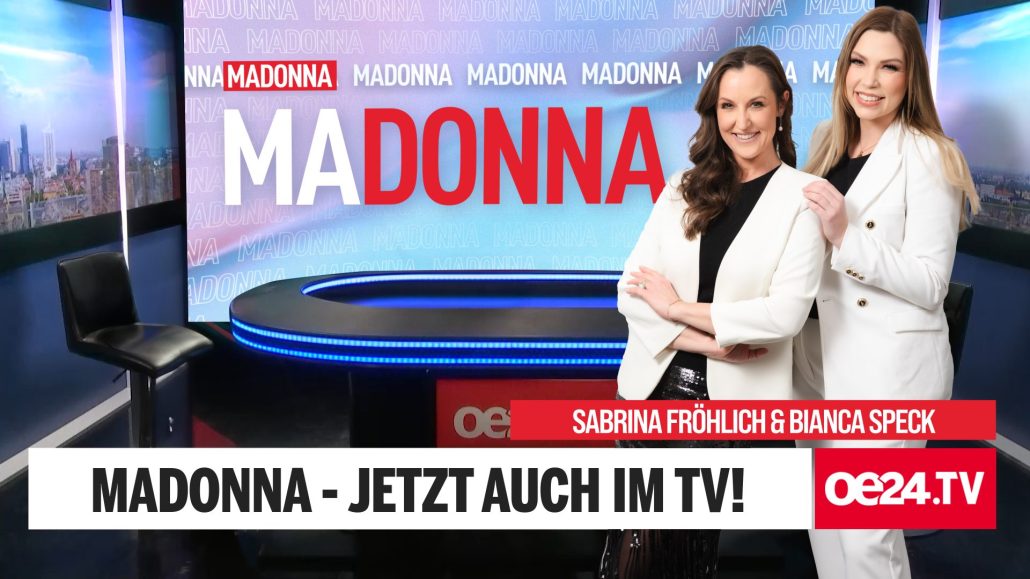1998 gingen die ersten freien Radios auf Sendung, mehr als zwei Jahrzehnte später kommt die Studie laut einer Presseaussendung zu dem Schluss, dass sich die nichtkommerziellen Radio- und Fernsehsender zu einer eigenständigen Institution entwickelt haben, die von einem gemeinsamen Selbstverständnis getragen wird. Dieser erbrachte “Public Value” könne weder vom öffentlich-rechtlichen noch dem privat-kommerziellen Rundfunk in dieser Form erbracht werden, heißt es.
Fokusgruppengespräche mit 120 vornehmlich ehrenamtlichen Mitarbeitern haben ergeben, dass sie sich in der Programmgestaltung senderübergreifend an verschiedenen kommunikativen Funktionen orientieren, die der Umsetzung spezifischer Werte dienen. So bieten die Sender den Menschen in ihren Verbreitungsgebieten die Möglichkeit, sich zu artikulieren und ihre Anliegen in den öffentlichen Diskurs einzubringen – das gelte besonders für Bevölkerungsgruppen, die sonst aus sozialen, kulturellen oder sprachlichen Gründen keine Stimme in der Öffentlichkeit haben. Auch erlauben sie es, dass Menschen an der Gestaltung am politischen Prozess aktiv teilnehmen. Die Radio- und TV-Sender decken demnach auch spezielle lokale Informationsbedürfnisse ab und greifen Themen auf, die in den Mainstream-Medien kaum vertreten seien. Zudem fördern sie der Studie zufolge kritische Medienkompetenz, etwa durch die Gestaltung eigener Medienbeiträge.
Weiterentwicklung der Förderrichtlinien
Die Autoren der Studie regen an, dass dieser demokratiepolitisch mehrfach relevante Mehrwert in eine Weiterentwicklung der Förderrichtlinien und eine Novellierung des KommAustria-Gesetzes einfließen sollte. Sie empfehlen beispielsweise eine langfristig wirksame Erhöhung des Fördervolumens und die Gliederung der Förderung in eine Sockel- und eine projektbezogene Zusatzförderung.
Die Untersuchung wurde für die RTR und das Forum Journalismus und Medien Wien (fjum) vom Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung (CMC) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und “COMMIT – Community Medien Institut für Weiterbildung, Forschung und Beratung” durchgeführt.
APA/red